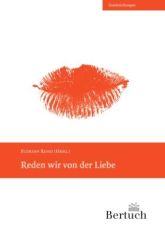Die Brandkatastrophe von 1842
Im Jahr 1842 wurde Hamburg von der größten Brandkatastrophe seiner Geschichte heimgesucht. Das Feuer brach am 5. Mai in der Deichstraße im Speicher eines Tabakhändlers aus. Die Ursache wurde nie geklärt. In wenigen Stunden breitete sich der Brand in der Hamburger Innenstadt aus. Er fand reichlich Nahrung in den eng nebeneinander stehenden Fachwerkhäusern und den Lagerhäusern der Kaufleute. Insgesamt fielen ihm 1850 Gebäude, darunter 100 Lagerhäuser, zum Opfer. Er verwüstete mehrere Stadteile, etwa ¼ der gesamten Stadt, die Petrikirche, älteste Pfarrkirche Hamburgs und die aus dem 12. Jahrhundert stammende Nikolaikirche. Auch das alte Rathaus fiel der Katastrophe zum Opfer. Es musste, um den Flammen den Weg zu versperren, gesprengt werden. Auch die Gebäude am alten Jungfern-stieg brannten völlig darnieder.
Das Feuer wütete nach Osten bis an die Alster, die glücklicherweise eine Barriere bildete. Die Kanäle, welche die Innenstadt durchzogen, boten diesen Schutz nicht. Die Winde wehten die Funken darüber hinweg. 51 Menschen kamen ums Leben, 130 Menschen wurden schwer verletzt, 20.000 obdachlos. Hamburg zählte damals ca. 200.000 Einwohner.
Die Löscharbeiten gingen nur schleppend voran. Es gab nur eine unzureichend ausgerüstete Feuerwehr. Mit Gummieimern, die von der Senatsverwaltung eilig verteilt wurden, nahmen die Bürger Wasser auf und versuchten mühsam ihre Gebäude zu retten. Am 8. Mai, fast 4 Tage nach Beginn, kam der Brand schließlich zum Stillstand. Ein Regen ging über Hamburg nieder und trug dazu bei, die Flammen zu löschen. Es dauerte viele Jahre, bis die betroffenen Viertel wieder hergerichtet waren. 1897, 55 Jahre nach dem Brand, wurde der Neubau des Rathauses an der kleinen Alster nach Plänen einer Hamburger Architektengemeinschaft abgeschlos-sen. Auch die zerstörten Kirchen wurden wieder errichtet.
Zwei Lehren zogen der Senat und die Bevölkerung von Hamburg aus der Katastrophe. Sie bauten die Straßen breiter, die neuen Häuser ohne Fachwerk und in größerem Abstand voneinander. Zum andern richteten sie eine hauptamtliche Feuerwehr ein und statteten sie mit den modernsten Ausrüstungsgegenständen aus. Glücklicherweise hat sich eine ähnliche Feuerbrunst, wie die von 1842, bis heute nicht wieder zugetragen. Für die erneute Zerstörung großer Teile Hamburgs in den Monaten Juli und August des Jahres 1943 („Operation Gomorrha") waren die Brandbomben des 2. Weltkrieges verantwortlich.
*****
Teaserfoto: Hopfenmarkt und Nicolaikirche in Flammen - gemeinfrei
Der Große Brand von 1842, gemalt von Peter Suhr 1842 - gemeinfrei